28. Presse 2007
Siehe auch die Kapitel Presse 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Tages Anzeiger
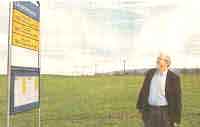
Flurnamen sollen gut lesbar sein
Flurnamen sollen gut lesbar sein
Tages Anzeiger vom 11. Januar 2007.
Mit Martin Schlatter sprach Sabine Arnold.
Vollständiger Text dieses
Zeitungsartikels (PDF, 507 KB)
Einige Zitate aus diesem Artikel:
- Landesweit wird heftig über die Schreibweise von Flurnamen getritten. Martin Schlatter aus der Au vertritt eine deutliche Meinung, gegen eine "extrem mundartliche" Schreibung.
- Martin Schlatter hat an der ETH Kulturingenieur studiert, diese Fachrichtung beschäftigt sich mit Vermessung, Planung und Umwelt. Seine berufliche Karriere begann er als Mitarbeiter in einem Geometerbüro in Adliswil. Seit 1989 leitet er das Zentrum für das geografische Informationssystem des Kantons Zürich (GIS-ZH). Seine Fachabteilung vernetzt unzählige raumbezogene Daten (z.B. Naturschutzgebiete, belastete Standorte, Haltestellen des ÖV oder statistische Daten). Der 51-jährige ist verheiratet, Vater zweier Söhne (16- und 19-jährig) und lebt seit gut 20 Jahren in der Au. (sa)
- Die Schweizerische Organisation für Geo-Information (SOGI) ist die schweizerische Dachorganisation für den interdisziplinären Einsatz von Geoinformation.
- Es ist das Anliegen der SOGI, Flurnamen nicht zu verändern, nur weil man sie sprachlich verbessern will.
- Verändern wir die Schreibweise der Flurnamen, müssen wir
schweizweit mit schätzungsweise 100 Millionen Franken Kosten
rechnen.
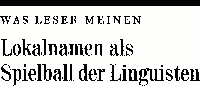

- auf die vorliegende Webseite und
- auf die Vernehmlassungsfrist vom 26. 02. 2007.
Text des Artikels (PDF, 443 KB)
tec21, Die Fachzeitschrift für Architektur, Ingenieurwesen und Umwelt, Nr. 6, Zürich, 5. Februar 2007. Seite 10, Rubrik Magazin.

Persönliche Bemerkungen des Redaktors dieser Webseite zum
nebenstehenden Interview im Sonntags-Blick: Martin Gurtner vom Bundesamt für
Landestopografie hat nach meiner Meinung den Verfasser des
Blick-Interviews Daniel Jaggi falsch informiert:
- Das Hochdeutsche habe sich eingeschlichen und nun herrsche ein
Sprach-Chaos.
Meine Meinung: Das Sprach-Chaos herrscht, weil im Widerspruch zur Weisung 1948 mit Unterstützung des Bundesamtes für Landestopografie begonnen wurde, eine mundartnahe Schreibweise einzuführen. - Jetzt sollen die Flurbezeichnungen wieder in den Dialekt
zurückübertragen werden.
Meine Meinung: Gemäss nationalrätlicher Debatte vom 6. März 2007 ist soll die heutige Schreibweise beibehalten werden. - Das Bundesamt für Landestopografie gebe noch dieses Jahr einen
Leitfaden heraus.
Meine Meinung: Gemäss den übereinstimmenden Stellungnahmen von Fachverbänden, Städteverband und Gemeindeverband dürfen keine neuen Vorschriften über die Schreibweise erlassen werden. Die Weisungen 1948 sind beizubehalten.

Sonntag-Blick vom 18. März 2007, Seite 18
Text des Interviews (PDF, 448 KB)
Wortlaut des Interviews:
Schluss mit Sprachsalat auf unseren Landkarten
CHAOS Unsere Landkarten sind so
schweizerisch, wie es nur geht: detailliert, umfassend, präzise.
Dennoch hat sich auch hier das Hochdeutsche eingeschlichen. Bei
Flurnamen herrscht teilweise ein regelrechtes Sprach-Chaos.Mal
heisst es "Bärenboden", mal "Bärebode", mal "Auf der Fluh", mal "Uf dr
Flue". Jetzt sollen die oftmals in Schriftsprache eingetragenen
Flurbezeichnungen wieder in den Dialekt zurückübertragen werden. "Uns
ist es ein Anliegen, dass sie den jeweils gesprochenen lokalen Dialekt
wiedergeben", sagt Martin Gurtner vom Bundesamt für Landestopografie.
Denn: "Unsere Karten sind ein Kulturgut."
Das Bundesamt für Landestopografie (Swisstopo) in Bern wird
deshalb noch dieses Jahr einen Leitfaden herausgeben.Dieser gilt
allerdings nur als Empfehlung, da jeder Kanton für die Schreibweise der
Namen selber zuständig ist. Gurtner: "Es macht aber schlicht keinen
Sinn, wenn beispielsweise der Kanton Zürich die Römerstrasse als
Römerstrasse bezeichnet und der Kanton Thurgau als
Röömerstroos."
DANIEL JAGGI
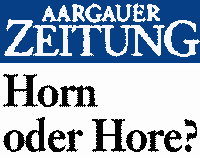
Aargauer Zeitung AZ vom 12. April 2007, Seiten 1 und 4
Daniel Friedli: Knatsch um Horen, Wäge und Fälder
Vollständiger Text (PDF; 364 KB)
Ausschnitte aus dem Text:
- Kulturingenieur Martin Schlatter, Vertreter der SOGI (Schweizerische Organisation für Geo-Information), warnt vor dem Aufwand bei einer Änderung der Schreibweise.
- Der Gemeindeverband befürchtet, dass eine Praxisänderung von den Ortsplänen bis hin zum Grundbuch erhebliche Umstellungs- und Anpassungskosten verursachen würde. "Es scheint eine Kleinigkeit zu sein, aber die Rechtssicherheit hängt daran, sagt Vizedirektorin Maria Luisa Zürcher."
- Die SBB wollen die alten Weisungen beibehalten, weil sie Angst davor haben, dass ihre Stationsnamen plötzlich nicht mehr mit den geografischen Namen übereinstimmen.
- Die Post gibt zu bedenken, dass mundartliche Schreibweisen ihr die Arbeit erschweren.
- Die Rettungsflugwacht pocht darauf, dass die Namen möglichst
leicht zu lesen seine. Sonst werde die telefonische Übermittlung im
Notfall schwieriger.
Basellandschaftliche Zeitung vom 12. April 2007
Daniel Friedli: Knatsch um Horen, Wäge und Fälder
Vollständiger Text (PDF, 27 KB)
Es handelt sich um denselben Text wie in der oben angeführten Aargauer Zeitung.

Solothurner Zeitung vom 12. April 2007
Daniel Friedli: Knatsch um Horen, Wäge und Fälder
Vollständiger Text (PDF, 25 KB)
Es handelt sich um ungefähr denselben Text wie in der oben angeführten Aargauer Zeitung.

Zofinger Tagblatt vom 12. April 2007
Daniel Friedli: Knatsch um Horen, Wäge und Fälder
Vollständiger Text (PDF, 58 KB)
Es handelt sich um ungefähr denselben Text wie in der oben angeführtenAargauer Zeitung.
Schaffhauser Nachrichten vom 16. April 2007, Seite 6
Daniel Friedli: Knatsch um Horen, Wäge und Fälder
Vollständiger Text (PDF; 529 KB)
Es handelt sich um ungefähr denselben Text wie in der oben angeführten Aargauer Zeitung.
Zusätzlich ist jedoch ein Kapitel beigefügt mit dem Titel:
"Dialektomanie: Schaffhauser Flurnamenkommission verwahrt sich dagegen".
Daraus geht hervor, dass die Schaffhauser Flurnamenkommission ihre Arbeit mit Unterstützung des Nationalfonds während einiger Jahre noch weiter fortsetzen wird.
Die Südostschweiz vom 20. April 2007
Daniel Friedli: Streit um Horen, Wäge, und Fälder auf neuen Landkarten
Vollständiger Text (PDF, 360 KB)
Es handelt sich um ungefähr denselben Text wie in der oben angeführten Aargauer Zeitung.
Werdenberger & Obertoggenburger vom 20. April 2007
Daniel Friedli: Streit um Horen, Wäge, und Fälder auf neuen Landkarten
Vollständiger Text (PDF, 351 KB)
Es handelt sich um ungefähr denselben Text wie in der oben angeführten Aargauer Zeitung.
Bote der Urschweiz
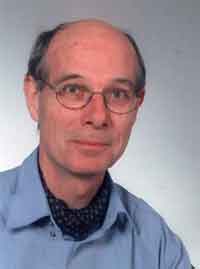
Dr. Viktor Weibel, Schwyz, Projekt Orts- und Flurnamenbuch des Kantons Schwyz und Mitglied der Nomenklaturkommissionen von Schwyz und Nidwalden.
In Zusammenarbeit mit dem Historiker Albert Hug schrieb er beispielsweise:
- Urner Namenbuch, 4 Bände, Altdorf 1988-1991,
- Nidwaldner Orts- und Flurnamen, 5 Bände, Stans 2003.
Bote der Urschweiz vom 20. April 2007
Daniel Friedli: Streit um Horen, Wäge, und Fälder auf neuen Landkarten
Es handelt sich vermutlich um ungefähr denselben Text wie in der oben angeführten Aargauer Zeitung.
Bote der Urschweiz vom 1. Mai 2007
Dr. Viktor Weibel: Leserbrief "Regelung wäre klar"
Vollständiger Text dieses Leserbriefes (PDF, 927 KB)
Ausschnitte aus diesem Leserbrief:
- Im Folgenden schreibe ich davon, wie das Problem der richtigen Schreibweise von Orts- und Flurnamen zumindest in den Kantonen Schwyz und Nidwalden angegangen wird. Die verantwortlichen Stellen benutzen die Daten, die ihnen die Namenforschung liefert. In Nidwalden betrifft dies das im Jahre 2003 erschienene Werk "Nidwaldner Orts- und Flurnamen" und in Schwyz die Daten aus dem Projekt "Orts- und Flurnamenbuch des Kantons Schwyz". Die Schreibweise der Namen basiert in beiden angezeigten kantonalen Forschungswerken auf den Wegweisungen, wie sie 1948 formuliert worden sind [Weisungen 1948]. Diese fordern eine mundartnahe Schreibweise, aber keine reine mundartliche Schreibweise.
- In Schwyz und Nidwalden hält man sich an die[se] moderaten und brauchbaren Weisungen [Weisungen 1948].
- Im Kanton Thurgau ist man etwas gar eigenmächtig dazu gekommen, die Namen sehr mundartgerecht zu schreiben, mit dem Nachteil, dass sie weder für Einheimische noch für Auswärtige leicht in ihrer Bedeutung erfasst werden können. Diese Art des Vollzugs hat wesentlich zum Aufstand der Gegner beigetragen. Aber letztlich ist das ein Problem des Kantons Thurgau, und man muss sich dort selber mit dem eigenen Kuckucksei herumschlagen, vor allem, weil man diesen Weg eigenmächtig und ohne Absprache mit den verschiedenen mit den Namenfragen beschäftigten Institutionen und Instanzen der Deutschschweiz begonnen hat.
- Es zeigt sich, dass man im Allgemeinen in jenen Kantonen, wo man
die oben erwähnte moderate mundartnahe Schreibweise [Weisungen 1948] verwendet, nur in
seltenen Fällen auf Unverständnis stösst.

NZZ am Sonntag
NZZ am Sonntag vom 17.Juni 2007
Markus Häfliger: Bund stoppt Dialektwelle auf der Landeskarte
Vollständiger Text (PDF, 587 KB)
Dieser Artikel nimmt Bezug auf das Kreisschreiben vom 6. Juni 2007 der Eidgenössischen Vermessungsdirektion an die kantonalen Vermessungsaufsichten.
Ausschnitte aus dem Text:
- Ein monatelanger Konflikt um die Lokal- und Flurnamen in den Landeskarten scheint gelöst: Der Bund weist die Kantone an, auf extrem mundartliche neue Schreibweisen zu verzichten.
- Solche [mundartnahe] Dialektformen seien für Auswärtige kaum lesbar, argumentiert die Schweizerische Organisation für Geo-Information (SOGI) im Internet.
- Jetzt versichert der stellvertretende Swisstopo-Direktor Fridolin Wicki, das Bundesamt habe "gar nie revolutionäre Änderungen geplant". Die Auseinandersetzung beruhe im Wesentlichen auf "Missverständnissen". Am 2. Mai haben sich die SOGI und Swisstopo in Zug zu einer Aussprache getroffen.
- Als Resultat hat Swisstopo den Brief verschickt; die SOGI musste sich verpflichten, sich nicht mehr in den Medien zum Sprachstreit zu äussen.
- Auf politischer Ebene kämpften unter anderem die Nationalratsmitglieder Kathy Riklin (cvp.) und Ruedi Aeschbacher (evp.) gegen die Mundartwelle.
Siehe auch Kommentar zu
diesem Artikel von Jens-Rainer Wiese.

LE TEMPS,1211 Genève 2
Le Temps vom 21. Juni 2007
Catherine Cossy: La topographie rendue folle par les dialectes
Vollständiger Text (PDF, 84 KB)
Ausschnitte aus dem Text:
- SUISSE ALEMANIQUE. Riispärg ou Risperg? Les cantons alémaniques
optent de plus en plus pour des noms de lieux dialectaux.
Polémique.
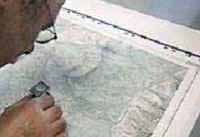
Dans les bureaux de Swisstopo à Wabern (BE) Photo: Keystone
- L'exemple est régulièrement cité pour démontrer la gravité du problème: les premiers secours ont eu toutes les peines à trouver le motard grièvement blessé qu'on leur avait signalé à la Kehlhofstrasse, parce qu'entre-temps, l'index des rues de la localité ne comportait plus qu'une Chälhofstrasse dans leur système de navigation par satellite.
- Alors que les petits Alémaniques sont de plus en plus tenus de pratiquer le Hochdeutsch dès le jardin d'enfants, il reste un champ d'action privilégié pour les défenseurs du dialecte: les cartes géographiques. Le sujet, identitaire, donc hautement émotionnel, refait régulièrement surface. Après avoir tenté maladroitement de mettre de l'ordre dans la transcription des noms locaux de Suisse alémanique, l'Office fédéral de la topographie Swisstopo essaie de freiner l'ardeur des tenants de la prononciation locale. Dans une circulaire envoyée au début de juin, les cantons sont priés de renoncer provisoirement à toute modification de leurs lieux-dits.
- A l'époque de la Carte Dufour, la mère de toutes les cartes nationales suisses établie par le durant la première moitié du XIXe siècle, on s'était contenté de préciser qu'un seul nom par lieu était autorisé, dans la langue parlée par une majorité de la population. Les premières - et dernières - directives datent de 1948 et n'existent qu'en allemand. Elles sont un compromis entre dialecte local et allemand écrit. Les noms facilement identifiables comme «Berg» et «Feld» par exemple devaient rester en Hochdeutsch et ne pas suivre toutes les accentuations possibles.
- Soucieux de «préciser quelques principes et d'éliminer les divergences», Swisstopo a voulu lancer un processus d'harmonisation. Mais son projet de nouvelles directives présenté en 2005 n'a fait que mettre de l'huile sur le feu. Le passage qui recommandait d'orthographier les noms locaux de moindre importance en tenant compte de leur prononciation habituelle sur place a suscité une vague de protestations.
- Jugeant que les directives de 1948 suffisent amplement, les géomètres et géographes rassemblés dans l'Organisation suisse pour l'information géographique ont plaidé pour que l'orthographe des noms locaux s'inspire du bon sens et ne suive pas forcément des considérations linguistiques et historiques savantes. Un ingénieur géomètre zurichois à la retraite entretient même un site internet particulièrement fourni et actuel sur lequel il traque toutes les inconséquences ( http://www.lokalnamen.ch).
- En Suisse romande, la question se pose avec beaucoup moins d'acuité. Mais les discussions n'en sont pas moins animées. André Jolidon, président jusqu'à la fin du mois de la commission vaudoise de nomenclature, précise: «Nous travaillons d'entente avec les municipalités. Nous leur demandons comment ils prononcent. Mais on ne force pas la main aux gens. Ce qui peut entraîner deux poids, deux mesures.»
Siehe auch Kommentar zu
diesem Artikel von Jens-Rainer Wiese.
8. Oktober 2007

Martin Schlatter, dipl. Ing. ETH, Leiter GIS-Zentrum beim Amt für Raumordnung und Vermessung der Baudirektion des Kantons Zürich.
Gebäudeadressierung im Bezirk Horgen
Zürichsee-Zeitung, Linkes Ufer, vom 8. Oktober 2007
Interview von Anja Müller mit Martin Schlatter.
Dieser Artikel zeigt an Beispielen den Zusammenhang zwischen Flurnamen und Strassennamen als Grundlagen für die eindeutige Gebäudeadressierung.
Vollständiger Artikel in der Zürichsee-Zeitung: PDF 1'010 KB
"Empfehlung zur Gebäudeadressierung und Schreibweise von Strassennamen",
verfasst von Martin Schlatter: PDF 1'441 KB
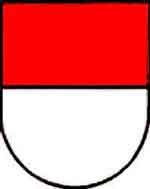
Christian von Arx: Vermessung ist nicht Forschung. Solothurner Zeitung vom 10. Oktober 2007.
Als Schlussfolgerung aus diesem Artikel ist zu unterscheiden zwischen::
- Amtliche Vermessung: Grundlage für Landeskarte, Grundbuchplan, Übersichtsplan und amtliche Register. Die einmal festgelegte Schreibweise soll unverändert bleiben.
- Forschung, z.B. Flurnamenbücher: Im August 2007 hat der Solothurner Regierungsrat der Forschungsstelle der Uni Basel Beiträge bewilligt für den Flurnamenband Dorneck-Thierstein. Die in Solothurn angesiedelte Forschungsstelle wird mit dem Projekt "Namenbuch der Nordwestschweiz" am Deutschen Seminar der Universität Basel vernetzt. Für die Schreibweise haben die Sprachwissenschafter Regeln erarbeitet, doch werden die Namen im Flurnamenbuch in verschiedenen Varianten - entsprechend den verwendeten Quellen - geschrieben und auch in der Lautschrift wiedergegeben.
Vollständiger Artikel in der Solothurner Zeitung: PDF 393 KB.
Die Südostschweiz vom 19. November 2007. Brigitte Tiefenauer:
- Gemeinden haben kein Gehör für neue Namen.
"Die laufende Bereinigung der Lokal- und Flurnamen stösst in den St. Galler Gemeinden auf wenig Gegenliebe." - "Äscherus - nöd zom Zuäluägä".
"Kulturhistoriker legen sich ins Zeug - für einige Buchstaben und viel Geld. Den Gemeinden ist dieses Vorgehen in der Form von Namensbereinigungen auf den Grundbuchplänen ein Dorn im Auge. Nun werden die Namenkundler gestoppt." - Im Notfallbereich unverantwortbar
"Offenbar hat man über dem Eifer, das Kulturgut zu wahren, die Aufgabe der Namen als Orientierungshilfen vergessen."
Dies sind einige Zitate aus dem zweiseitigen Text. Vollständiger Text (PDF, 1'050 KB)